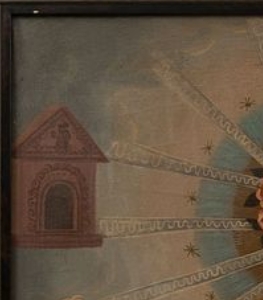Christiane Wollenhaupt-Brenner (1935-2006): Apsisfenster der Klosterkirche Lippoldsberg (1956)
Die mittelalterliche Kirche von Lippoldsberg (Nordhessen) gehörte einst zu dem Benediktinerinnenkloster St. Maria und Georg und ist heute eine evangelische Kirche. Der Bau wurde im 20. Jahrhundert um einige wenige Kunstwerke ergänzt, die ganz bewusst apokalyptische Akzente setzen sollen. An erster Stelle ist das zentrale Apsisfenster zu nennen. Hier kam es zu einer Ende der 1950er Jahre merkwürdigen Umkehrung der Farbwahl: Die damals noch vorhandenen farbigen, zum Teil romanischen Wandmalereien verschwanden unter einer weißlichen Tünche. Die weißmilchige Verglasung des Apisfensters wurde hingegen ausgetauscht durch ein neues, damals modern empfundenes Buntglasfenster. Es geht zurück auf einen Entwurf der Kasseler Künstlerin Christiane Wollenhaupt-Brenner (1935-2006). Diese hatte sich mit mittelalterlicher Kunst und Byzantinistik beschäftigt, was sich auch in ihren Arbeiten wiederspiegelt, die daher für einen im Kern romanischen Bau geeignet schienen. Das Fenster wurde im Zuge von Restaurierungen 1956 eingebaut, es war damals der erste Schritt von Umbauten, die sich bis 1959 hinzogen.

Oben erscheint Christus in einer Mandorla, von sieben Engeln umgeben. Im zu Füßen finden sich fünf Tore der Stadt. Alle Tore sind ähnlich gehalten: Es sind einfache Rundbögen, die sich zwei Farben teilen. Die größere Hälfte ist lilafarbig, die kleinere Hälfte (die Laibung des Tores) ist entweder rot oder weiß. Sieben weitere Tore ziehen sich in einem Band nach unten, zusammen entsteht die Form eines Kreuzes. Mehrere gelbe Scheiben lassen das Kreuz gut erkennen. Zurückhaltender sind feine Binnenzeichnungen (Rundbögen, Nägel, Schraffuren), die einige der gelben und vereinzelt auch andere Scheiben strukturieren; ihre Funktion ist unklar. Die menschlichen Gruppen an den Seiten des Bandes sollen die sieben Gemeinden andeuten, zu denen die Menschen strömen. Eigentlich sind die sieben Gemeinden ein schützender Ort, und das Neue Jerusalem sogar ein Ort der Freude, hier aber sehen viele Gesichter leidtragend und etwas traurig aus, als würde die Erlösung noch bevorstehen. Regelrecht grimmig und mit heruntergezogenen Mundwinkeln sind Christus und die Engel gezeichnet, was im Gesamteindruck etwas durch die starken und kräftigen Primärfarben, die diese Glasarbeit prägen, abgemildert wird.

1999 wurde das Fenster durch einen Leuchter im Apsisbereich ergänzt, der nochmals den Bezug zum Himmlischen Jerusalem dezent unterstreicht. Es ist eine Arbeit aus dem Haus „Professor Schürmann & Partner“ aus Köln, an dem noch der Architekt Joachim Schürmann (1926-2022) mitwirkte, der dazu Auskunft gab: „Das Glasfenster in seiner Schlichtheit und Suggestivkraft gab den Impuls, das natürliche ‚Licht‘ auf der anderen Seite durch ein künstliches Licht zu ergänzen. Die Assoziation zu der Stadt Jerusalem wird durch den Ort, den Altarbereich mit seiner Feier des Allerheiligsten, unterstrichen. Hier kam nur ein Radleuchter in Frage, der die weichen Formen der umliegenden Gurt- und Jochbögen aufnimmt. Die Beziehung von Architektur und Skulptur war mir immer ein herausragendes Anliegen.“ In seiner Ausgestaltung, vor allem mittels Edelstahl und zwölf Tropfenlampen, modern soll er doch an die mittelalterlichen Radleuchter – namentlich genannt wurden Hildesheim – anlehnen. Zusammen mit dem Buntglasfenster entstand so ein intimer Apsisbereich, der gerne für Meditationen, Gottesdienste aber auch Konzerte genutzt wird.
Dieter Grossmann: Kirche und Kloster St. Georg, Lippoldsberg 1961.
Mareike Liedmann: Die Klosterkirche Lippoldsberg und die Frage mittelalterlicher Architekturrezeption zwischen Weser und Ostsee, Regensburg 2018.